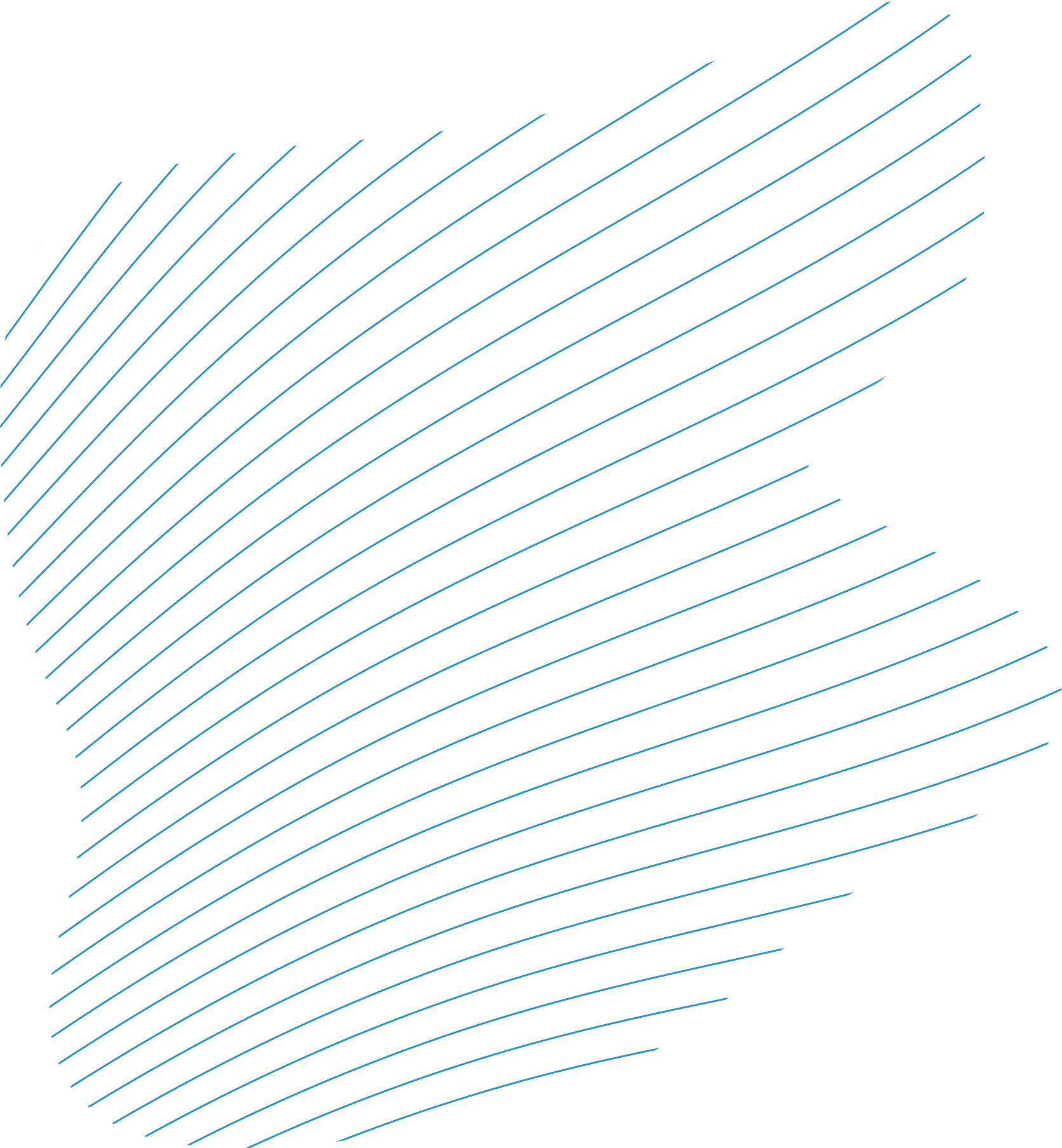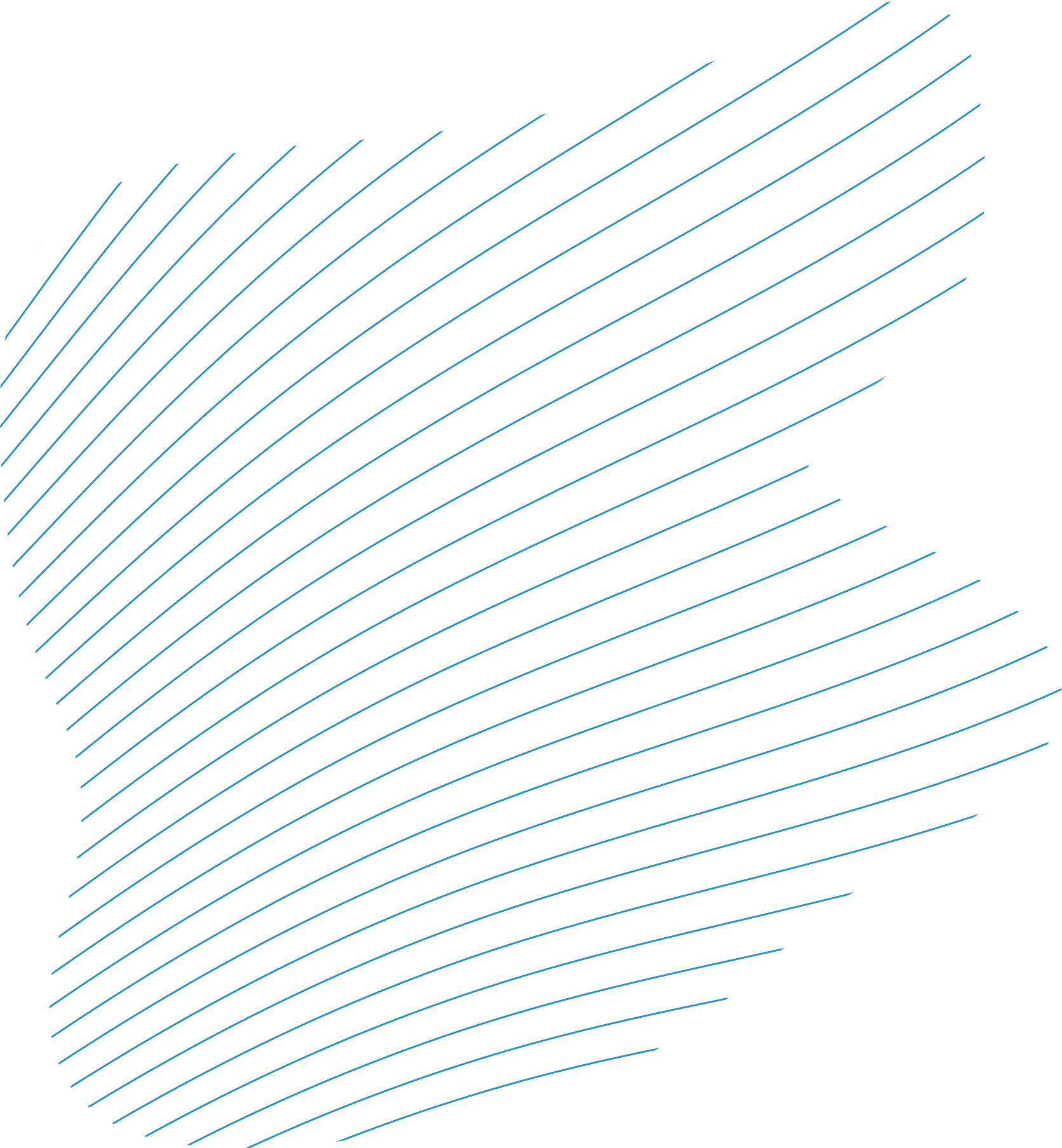


| Lage des Kraftwerks | Stadt Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen |
| Kraftwerkstyp | Braunkohlenkraftwerk |
| Inbetriebnahme | 1955-1970 |
| Leistung (brutto) | stillgelegt |
Viele Inbetriebnahmen, wachsende Dimensionen
1953 wurde mit dem Bau des Kraftwerks Frimmersdorf II begonnen. Es sollte der Nachfolger einer 1926 errichteten, längst abgerissenen Anlage werden. Zwischen 1955 und 1970 wurden in kurzen Abständen zwei 100-, zwölf 150- und zwei 300-Megawatt-Kraftwerksblöcke fertiggestellt. Alle Blöcke sind mittlerweile stillgelegt worden. (Foto: Historisches Konzernarchiv RWE)
Traditionsreicher Energiestandort fast 100 Jahre lang aktiv
Die beiden 300er-Blöcke P und Q zum Beispiel, im Volksmund „Paula” und „Quelle“ genannt, hatten seit ihrer Inbetriebnahme in zusammen 700.000 Betriebsstunden 244 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit könnte man rein rechnerisch sämtliche Stromverbraucher Düsseldorfs 60 Jahre lang versorgen. Der gesamte Standort Frimmersdorf II hat seit Bestehen fast 1000 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt - genug, um Düsseldorf 250 Jahre unter Strom zu halten.
Fester Fahrplan für das Ende der Braunkohleverstromung
Von den revierweiten Stilllegungen gemäß Kohleausstiegsgesetz sind bis 2030 rund 6.000 Beschäftigte der RWE Power betroffen. Ein Ende August 2020 abgeschlossener Tarifvertrag stellt sicher, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt und die Stilllegungen sozialverträglich gestaltet werden. Dazu trägt auch das sogenannte Anpassungsgeld bei, eine Staatshilfe für die betroffenen Beschäftigten. Der konsequente und verlässliche schrittweise Ausstieg aus der Kohle ist in vollem Gange und ein weiterer wichtiger Bestandteil der Transformation von RWE zu einem der weltweit führenden Betreiber von Erneuerbaren Energien.
Neue Perspektiven
Das Kraftwerk Frimmersdorf wird in den nächsten Jahren größtenteils zurückgebaut, um Platz für neue Industrien zu schaffen. Die markante Maschinenhalle und einige benachbarte Anlagenteile bleiben jedoch im Sinne der industriekulturellen Denkmalpflege erhalten. Dort werden Flächen für Büros und Rechenzentren entstehen.